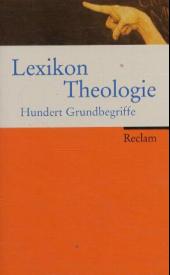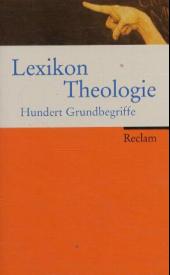|
Artikelverwaltung
1. Abendmahl/Eucharistie - Ulrich Kühn
2. Aberglaube - Dieter Harmening
3. Amt - Alf Christophersen
4. Anthropologie - Oswald Bayer
5. Apokalyptik - Ferdinand Hahn
6. Apologetik/Kontroverstheologie - Jörg Haustein
7. Atheismus - Jochen Christoph Kaiser
8. Auferstehung - Bernd Oberdorfer
9. Aufklärung - Markus Ries
10. Bekenntnisschriften - Jörg Lauster
11. Bibel - Thomas Söding
12. Bund - Bernd Janowski
13. Buße (mit Beichte) - Dorothea Sattler
14. Christentum - Christian Albrecht
15. Christologie - Karl H. Ohlig
16. Deismus/Theismus - Dirk Fleischer
17. Diakonie - Konrad Hilpert
18. Dogmatik - Dietrich Korsch
19. Engel - Herbert Vorgrimler
20. Eschatologie - Jörg Frey
21. Esoterik - Julia Iwersen
22. Ethik - Friedrich Wilhelm Graf
23. Evangelium - Otto Hermann Pesch
24. Exegese - Jörg Frey
25. Feiertage, kirchliche - Markus Ries
26. Feministische Theologie - Ute Gause
27. Freiheit - Reiner Anselm
28. Fundamentalismus - Günter Frank
29. Gebet - Carsten Claußen
30. Geist, Heiliger - Michael Welker
31. Gemeinde - Carsten Claußen
32. Gender Forschung - Ute Gause
33. Gerechtigkeit - Ferdinand Hahn
34. Geschichte - Stefan Jordan
35. Gesetz - Gerhard Sauter
36. Gewissen - Reiner Anselm
37. Glaube - Jörg Dierken
38. Gnade - Dorothea Sattler
39. Gott - Wilfried Härle
40. Hermeneutik - Gunter Scholtz
41. Hoffnung - Markus Buntfuß
42. Hölle - Herbert Vorgrimler
43. Homiletik/Predigt - Schmidt-Rost
44. Humanismus - Ute Gause
45. Inkarnation - Christina Hoegen-Rohls
46. Judentum - J. u. R. Bernstein
47. Katholizismus - Karl Kard. Lehmann
48. Kirche - Peter Neuner
49. Kirchengeschichte - Manfred Weitlauff
50. Kirchenrecht/Kanonistik - Heinrich deWall
51. Konfession/Konfessionalisierung - Anselm Schubert
52. Konzil - Peter Neuner
53. Kreuz - Walter Sparn
54. Leben-Jesu-Forschung - Alf Christophersen
55. Lehrentscheidungen - Sabine Demel
56. Maria/Mariologie - Leo Kard. Scheffczyk
57. Mission/Missionswissenschaft - Theodor Ahrens
58. Modernismus - Manfred Weitlauff
59. Moral - Konrad Hilpert
60. Mystik - Ulrich Köpf
61. Mythos - Wolfgang Nethöfel
62. Ökumene - Friederike Nüssel
63. Offenbarung - Siegfried Weichlein
64. Opfer - Bernd Janowski
65. Orthodoxie, kirchliche - Jennifer Wasmuth
66. Papst - Wolfgang Beinert
67. Pietismus - Johannes Wallmann
68. Praktische Theologie - Wilhelm Gräb
69. Prophetie - Jörg Jeremias
70. Protestantismus - Friedrich Wilhelm Graf
71. Rechtfertigungslehre - Otto Hermann Pesch
72. Reformation - Thomas Kaufmann
73. Religion - Karl-Heinz Ohlig
74. Religionskritik - Jochen Christoph Kaiser
75. Religionspädagogik - Ulrich Schwab
76. Religionsphilosophie - Günter Frank
77. Religionspsychologie - Rudolf-Christian Henning
78. Religionssoziologie - Volkhard Krech
79. Religionswissenschaft - Jörg Dierken
80. Sakrament - Herbert Vorgrimler
81. Schöpfungslehre - Walter Dietz
82. Scholastik/Neuscholastik - Rolf Schönberger
83. Segen - Matthias Wolfes
84. Sekte - Hans Gasper
85. Soteriologie - Oswald Bayer
86. Sünde - Christine Axt-Piscalar
87. Systematische Theologie - Georg Pfleiderer
88. Taufe - Martin Laube
89. Teufel/Antichrist - Jürgen Bründl
90. Theodizee - Wilfried Härle
91. Theologie - Eilert Herms
92. Tod - Wolfgang Beinert
93. Tradition - Sabine Demel
94. Trinität - Bernd Oberdorfer
95. Urchristentum - Cilliers Breytenbach
96. Vernunft - Friedemann Voigt
97. Versöhnung - Otfried Hofius
98. Wahrheit - Reinold Schmücker
99. Weltreligionen - Karl-Heinz Ohlig
100. Wunder - Bernd Kollmann
Hinweise für die Autoren des
Lexikons Theologie. Hundert Grundbegriffe
1. Das Lexikon ist als Propädeutikum gedacht. Seine Sprache muß daher leicht verständlich sein. Bitte vermeiden Sie lange Satzkonstruktionen und unnötige Fremdworte. Unverzichtbare Fremdworte sollten - wenn es sich um Fachbegriffe handelt, die nicht ebenfalls auf der Stichwortliste vertreten sind - kurz paraphrasiert werden.
2. Bemühen Sie sich bitte um eine Gleichgewichtung verschiedener von Ihnen vorgestellter Definitionen und Positionen. Weder sollte der Artikel benutzt werden, um eine einzige Definition Ihres Begriffs als alleingültige auszuweisen, noch um nur neue Definitionen vorzustellen. Wünschenswert ist es aber, wenn am Textende Ausblicke über neuere Definitionsansätze oder mögliche Perspektiven für das Stichwort eröffnet werden.
3. Der Aufbau der Artikel folgt einem fünfteiligen Schema, das unbedingt einzuhalten ist:
a) einem Titelkopf mit Angabe des Stichworts (ohne weitere Auszeichnungen);
b) einer Kurzdefinition des vorgestellten Begriffs;
c) einer Entwicklungsgeschichte des Begriffs mit Vorstellung der wichtigsten Definitionen und ihrer Vertreter;
d) einer Kurzbibliographie, die wichtige Titel enthält, die im Text noch nicht genannt sind (max. 5 Titel sowie Hinweise auf Artikel in anderen Lexika [s.u. 6.c.]).
e) dem Verfassernamen.
4. Bitte kürzen Sie im Text nur das betreffende Stichwort, das Wort Jahrhundert (Jh.) und Elemente ab, die eine Aufzählung einleiten (z. B., usw., u. a.).
5. Geben Sie bitte stets alle Vornamen erwähnter Personen vollständig an.
6. Verweise auf zitierte Werke erfolgen:
a) im Text in Klammern unter Angabe des Werktitels bzw. auch der dt. Übersetzung kursiv und des Erscheinungsjahrs; Beispiel: (Robert K. Merton, On the shoulders of giants, 1965; dt. Auf den Schultern von Riesen, 1989).
b) in der Kurzbibliographie mit ausgeschriebenem Vornamen und Namen, ggf. (Hrsg.): vollständigem Haupttitel. Erscheinungsort und -jahr (erste Auflage bzw. benutzte Auflage), Seitenzahl (bei Aufsätzen und Artikeln); Beispiele: 1. Friedrich Wilhelm Graf: Theonomie. Fallstudien zum Integrationsanspruch neuzeitlicher Theologie. Gütersloh 1987. 2. Peter Hünermann: Amt und Evangelium - Die Gestalt des Petrusdienstes am Ende des zweiten Jahrtausends. In: Herder-Korrespondenz 50 (1996). S. 298-302. 3. Theo Kobusch: Die dialogische Philosophie Platons (nach Schlegel, Schleiermacher und Solger). In: Ders. u. Burckhard Mojsisch (Hrsg.): Platon in der abendländischen Geistesgeschichte. Darmstadt 1997. S. 210-25.
c) Im Anschluß an die maximal fünf Titel umfassende Kurzbibliographie folgt eine Zeile, in der auf das Vorkommen des betreffenden Stichworts in anderen einschlägigen theologischen Lexika hingewiesen wird. Bitte geben Sie hier unter Verwendung der gängigen Abkürzung an, ob Ihr Stichwort z. B. auch im LThK3, in RGG4 (oder einer früheren Auflage), im EKL o.ä. behandelt wird.
d) Verwenden Sie bitte in den Literaturhinweisen keine Auszeichnungen.
7. Bitte legen Sie Wert auf "Intertextualität" und versuchen Sie, auf andere Stichworte zu verweisen. Diese Verweise werden im Text durch (SW Name des Stichworts) gekennzeichnet.
8. Bitte halten Sie unbedingt den vorgegebenen Umfang ein. Wir erlangen nur dadurch einen finanziell auch für Schüler und Studenten möglichen Rahmen von etwa € 10,- in der Taschenbuchausgabe, wenn die Gesamtseitenzahl die Vorgabe nicht überschreitet. Bei zu langen Manuskripten sind Kürzungen unvermeidlich. Eine Druckseite der Universal-Bibliothek enthält ca. 1800 Zeichen und entspricht einer Manuskriptseite von je 60 Anschlägen in 30 Zeilen.
9. Reichen Sie Ihren Artikel im "Rich Text Format" (rtf.) oder als winword-Dokument (doc.) ein. Schreiben Sie den Text des Artikels und die Literaturhinweise im selben Schriftgrad und mit gleichem, mindestens 1 1/2fachen Zeilenabstand.
10. Als letztes die wichtigste Bitte: Der Band kann erst zum Druck gehen, wenn der letzte Artikel redigiert vorliegt. Bitte senden Sie Ihren Artikel daher fristgemäß ein.
Alf Christophersen, Stefan Jordan, München, Mai 2002
|
Lexikon Theologie. Hundert Grundbegriffe
Musterartikel
|
|
Leben-Jesu-Forschung
Als L.-J.-F. bezeichnet man die seit der Aufklärung (SW Aufklärung) betriebene wissenschaftliche Erforschung des Lebens des historischen Jesus. Die Geschichte der L.-J.-F. läßt sich in fünf Phasen einteilen:
1. Erste kritische Anstöße stammen aus dem engl. Deismus (SW Deismus) des 18. Jh., von Hermann Samuel Reimarus, Gotthold Ephraim Lessing, Johann Gottfried Herder und Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, von dem die erste Vorlesung über das Leben Jesu stammt (Wintersemester 1817/18). Eigentlicher Beginn der L.-J.-F. war David Friedrich Strauß' Versuch, anhand des Johannesevangeliums den Stoff der Evangelien als mythisch (SW Mythos), also ungeschichtlich, zu erweisen (Leben Jesu, 2 Bde., 1835/36).
2. Erst quellenkritische Einsichten, die nach Strauß erlangt wurden, gaben der "Liberalen L.-J.-F." im letzten Drittel des 19. Jh. eine methodische Grundlage. Sie beruht auf der ‚Literarkritik' und sieht im Markusevangelium und einer ‚Logienquelle' die Grundlage für die biographische Rekonstruktion des Lebens Jesu mit den Mitteln historischer Kritik (Heinrich Julius Holtzmann, Die synoptischen Evangelien, 1863).
3. Diese Ergebnisse wurden im Rückgriff auf Albert Schweitzer und William Wrede (Das Messiasgeheimnis, 1901) von Martin Dibelius (Formgeschichte des Evangeliums, 1919, 19332) und Rudolf Bultmann (Geschichte der Synoptischen Tradition, 1921) radikal in Frage gestellt. Bultmann destruierte die Interpretation der Verkündigung Jesu als Ankündigung eines geistlichen Gottesreichs (Theologie des NT, 1953). Maßgeblich war die Erkenntnis, daß auch das Markusevangelium keine historische Quelle, sondern eine dogmatische (SW Dogmatik) Konzeption sei. Die Möglichkeit, den historischen Jesus darstellen zu können, schien zweifelhaft. Als wegweisend erwiesen sich die Erkenntnisse der formgeschichtlichen und redaktionsgeschichtlichen Evangelienforschung. In den Mittelpunkt trat der kerygmatische Charakter der Überlieferung, der dem Gemeindeglauben (SW Gemeinde) und nicht einem historischen Rekonstruktionsbemühen entsprang.
4. An diese Entwicklung schloß sich die von Ernst Käsemann, aber etwa auch Ernst Fuchs, Günther Bornkamm und Gerhard Ebeling gestellte "neue Frage" an, die die Identität von historischem Jesus und nachösterlichem Christus im Glauben postulierte; sowohl kritische Maßstäbe zur Feststellung der alten Jesusüberlieferung als auch die Einsicht in Zusammenhang und Gegensatz zwischen Jesusüberlieferung und zeitgenössischem Judentum (SW Judentum) dienten zur Erlangung eines Bestands an Quellen, der zur Darstellung eines wissenschaftlichen Jesusbildes genüge (Das Problem des historischen Jesus [1954], in: ders., Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. I, 1960).
5. Unter Einsatz die Grenzen des Kanons überschreitender jüd.-biblischer Deutungsmuster, Aufnahme soziologischer Prämissen (SW Religionssoziologie) und Betonung der Kontinuität zwischen historischem Jesus und nachösterlichem Christus bemüht sich gegenwärtig die 'third quest' for the historical Jesus, ihn als Begründer einer "innerjüdischen Erneuerungsbewegung" zu sehen (Ed Parish Sanders, Jesus and Judaism, 1985; John Dominic Crossan, The Cross the Spoke, 1988).
- LThK3; RGG3; TRE.
- Albert Schweitzer: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung [1906]. Tübingen 91984.
- Ernst Fuchs: Die Frage nach dem historischen Jesus. In: Zeitschrift für Theologie und Kirche 53 (1956). S. 210-29.
- Gerhard Ebeling: Jesus und Glaube. In: Zeitschrift für Theologie und Kirche 55 (1958). S. 64-110.
- Werner Georg Kümmel: Vierzig Jahre Jesusforschung (1950-1990). Weinheim 1994.
- Gerd Theißen u. Annette Merz: Der historische Jesus. Ein Lehrbuch. Göttingen 1996. 32001.
Alf Christophersen
3696 Zeichen
|
|